Virtuositätskritik um 1900, Annotationskritik um 2010
Universitätsbibliothek Graz
Das ist die Kunst mir nicht wert. Virtuositäts-Kritik um 1900. In: Virtuosität. Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst der Moderne. Hrsg. v. Hans-Georg von Arburg u. a. Göttingen: Wallstein 2006, S. 235–249.
Exemplar: Universitätsbibliothek Graz, Hauptbibliothek, Magazin. Signatur: I 526472
Der bzw. die anonyme Notator:in hat den Text nachweislich bis Seite 239 gelesen. Bis dorthin wurde der Begriff der Virtuosität diskutiert, konkreter: die Bedeutung, in der dieser Begriff um 1900 begegnet, nämlich als Meisterschaft im Kleinen, im Performativen, Kurzlebigen, Randständigen. Das ehemals künstlerische Attribut schlechthin „marginalisiert[e] sich“ (Seite 235); Hugo von Hofmannsthal etwa spreche noch vom „Virtuosen der Anempfindung“ (ebd.) beim Nachahmen fremder Ideen und Emotionen.
Es ist schwer zu sagen, ab welchem Punkt der Lektüre der oder die Notator:in sich erkannt, ertappt, durchschaut fühlt. Sicher ist, dass seine bzw. ihre Lesart nicht die einzige, auch nicht die naheliegendste ist, sondern dass sie in direkter Wechselwirkung zur eigenen Situation steht. So wird er oder sie sich im Rahmen der Lektüre plötzlich selbst gegenwärtig – und dabei höchst dubios: Das eigene Tun, das Unterstreichen, zeigt immer deutlichere Entsprechungen zum Text. Worum sonst handelt es sich denn dabei, wenn nicht um jene „Anempfindung“ geistigen Inhalts, von der Hofmannsthal spricht! Hier ist dem Lesevorgang, dem ganzen Studium – dem ganzen Leben? – ein Spiegel vorgehalten. Vom zweifelhaften ‚Randständigen‘ muss hier gerade jemand lesen, der oder die da Striche und Pfeilchen in die Marginalspalte setzt.
Die eigene Haltung (so muss man das zweifelsohne rekonstruieren) wird sofort sinnbildlich und symptomatisch. Über die Gemeinsamkeit der Randständigkeit gelten die Verdikte zur Virtuosität nun auch dem Notieren in der Marginalspalte, wohl auch über die Gemeinsamkeit der Performanz, die dem händischen Annotat stets ablesbar bleibt. Dazu kommt die gravierende moralische Implikation: Die wichtigste Unterstreichung (mit Kommentar!) gilt schon auf der zweiten Seite des Textes gerade dem Anstand, der dem Virtuosen fehle: „Der Gegenspieler des virtuosen Künstlers ist der Anständige.“ (S. 236)
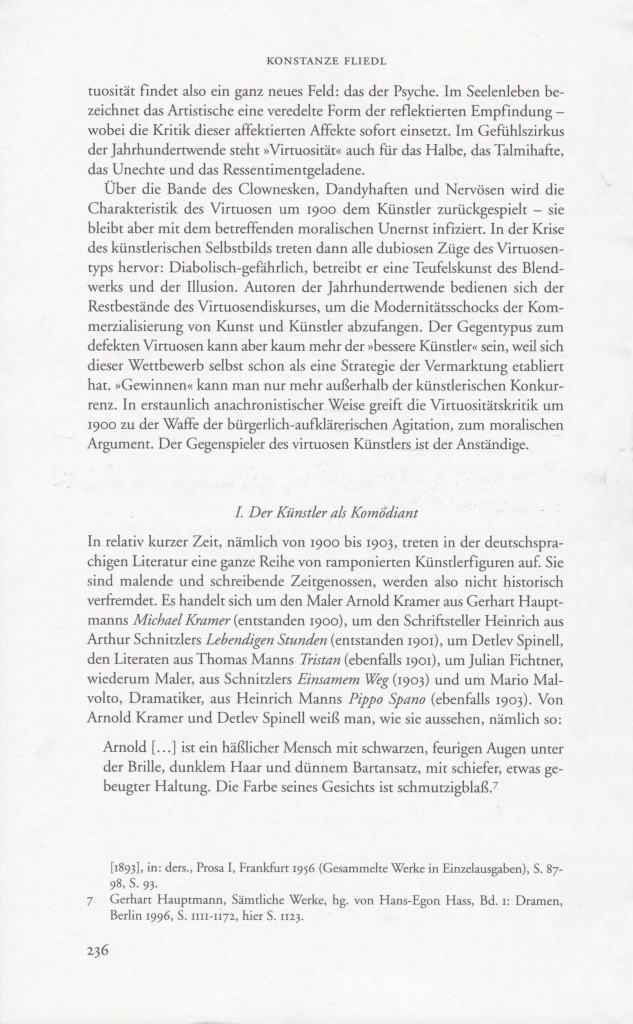
Langsam setzt Läuterung ein: Anfangs noch tastend, im ersten Schock weiterlesend – unwillkürlich auch weiter unterstreichend – bis zur Textpassage Seite 238 unten / Seite 239 oben, wird dem oder der Fehlgeleiteten hier nun ein neuer Pfad eröffnet: Rückzug, Vergeistigung. Im Gegensatz zur artistischen Vorführung, der vor Publikum bezeugten Meisterschaft im Performativen (hier liest er oder sie schon ganz selbstverständlich: im Gegensatz zur Performanz auch der Annotation) steht der, der sich abseits hält, der im Geheimen, Unsichtbaren schafft. Der Schreibende, heißt es in der letzten unterstrichenen Passage, „spielt praktisch keine Rolle, er hinterläßt nicht einmal mehr sichtbare Spuren.“
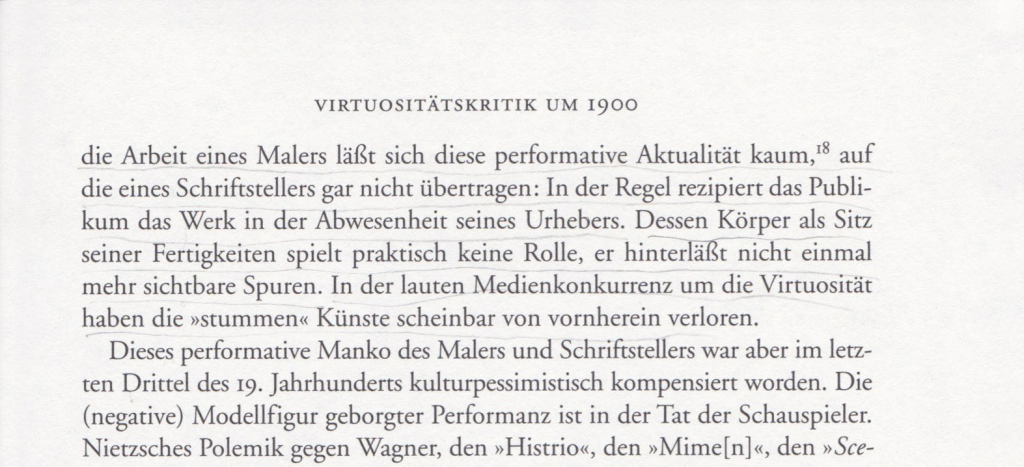
Diese Passage hallt im Notator, in der Notatorin lange nach: „… hinterläßt nicht einmal mehr sichtbare Spuren.“ Das ist es, hier liegt der Wendepunkt: Zur Umkehr bewegt, radiert er oder sie die eigenen Unterstreichungen aus, blättert zurück, radiert weiter – bis auch die letzten Spuren (beinahe) ausgetilgt sind.